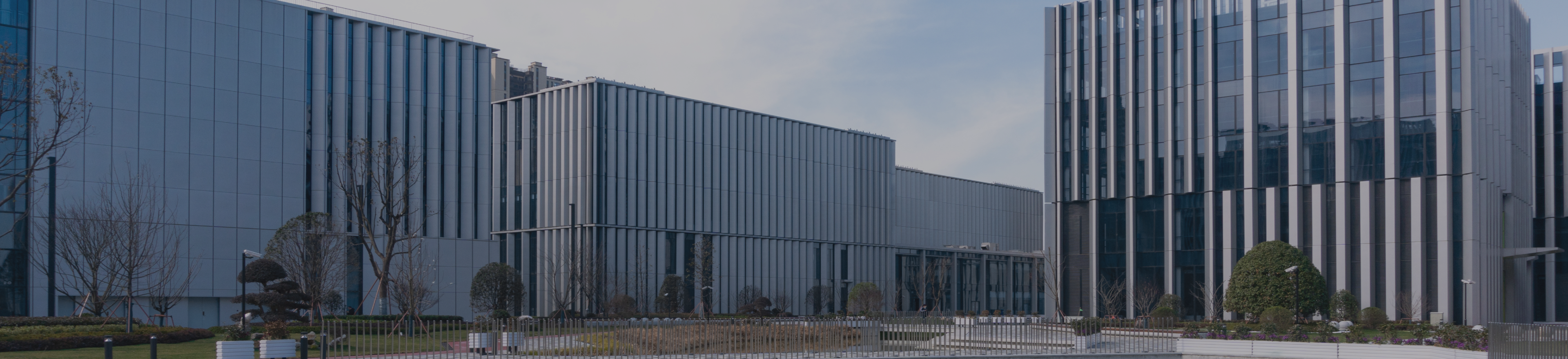1. Einleitung: Der neue Motor der modernen Energiewende
Mit der Umstrukturierung des globalen Energiesystems und der schnellen Einführung von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien bleibt die Volatilität dezentraler Energiequellen, insbesondere Solar- und Windenergie, eine entscheidende Herausforderung für das reibungslose Funktionieren von Stromnetzen. In diesem Zusammenhang stellen Virtuelle Kraftwerke (VPPs) eine zentrale Lösung dar, um die Integration dezentraler Energiequellen zu ermöglichen, die Leistungsverteilung zu optimieren und die Effizienz der Energieverwendung zu verbessern. Für Industrie- und Gewerbeunternehmen, die auf kohlenstoffarme Betriebsabläufe, Kostenkontrolle und die Integration neuer Energietechnologien setzen, fungieren VPPs aus strategischer Sicht als nachhaltige technische Lösung zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit ihres neuen Energiesystems.
2. Kernwert und Funktionsmechanismus Virtueller Kraftwerke
2.1 Überwindung der „Zersplitterung“, um „Aggregation“ zu erreichen
Virtuelle Kraftwerke nutzen fortschrittliche Technologien, um geografisch verteilte und sektorale dezentrale Energiequellen zu integrieren. Dazu gehören kommerzielle und industrielle Photovoltaikanlagen auf Dächern, regelbare Lastsysteme sowie Energiespeichersysteme. Durch diese Aggregation können kleinere und räumlich verteilte Energiequellen zusammenwirken und „virtuell“ als einheitliche Stromerzeugungs- und flexibel regulierbare Einheit agieren, wodurch ihre Teilnahme am Stromhandelsmarkt ermöglicht wird. Diese Teilnahme beinhaltet auch die Echtzeit-Frequenzregelung, eine Funktion, die bisher großen konventionellen Kraftwerken vorbehalten war. Beispielsweise greifen VPPs in Spitzenlastzeiten ferngesteuert auf dezentrale Unternehmens-Energiespeicher zu, um die Belastung des Netzes zu verringern, während sie in Zeiten geringer Nachfrage die Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energien unterstützen und somit die im modernen Stromsystem erforderliche „Lastspitzenabsenkung und Auffüllung von Lasttälern“ (peak shaving and valley filling) durchführen.
2.2 Schaffung eines Win-Win-Musters für Unternehmen und Netze
Im Fall von Industrie- und Handelsunternehmen kann die freiwillige Teilnahme an VPP-Projekten wirtschaftliche Vorteile bringen und Sicherheit hinsichtlich der zukünftigen Energieverfügbarkeit bieten. Unternehmen können subventionierte Zahlungen erhalten und profitieren von der Möglichkeit, „virtuelle Kraftwerks“-VPP-Projekte als Energiespeicherressourcen in Zeiten hoher Nachfrage zu nutzen. Kunden können ihren internen Energieverbrauch optimieren und strukturell Lastspitzenüberschüsse in regulierten Märkten eliminieren, wenn VPPs überschüssige Energie zur geplanten Spitzenlastdeckung aufnehmen. Alternativ profitieren Netzkunden von geplanter Soft-Last im Falle von Netzstörungen, wodurch die Backup-Stromversorgung über die Soft-Last die Trennung vom Stromnetz, Stromleitungsausfälle oder vorgeschriebene Netztrennungen umgehen kann. Für Stromnetze bestehen die wirtschaftlichen Vorteile von VPPs in der Bereitstellung von Soft-Last und der Anpassung der Spitzenlast zur rechtzeitigen Kapazitätserweiterung beziehungsweise Kapazitätsregelung durch Netz-Drosselung in regulierten Märkten. VPPs tragen zudem dazu bei, die Stabilität und Flexibilität von Stromsystemen zu erhöhen.
3. Integration von virtuellen Kraftwerken und Speicherlösungen
Damit virtuelle Kraftwerke optimal funktionieren können, müssen sie fortschrittliche und zuverlässige Energiespeicherlösungen integrieren. Industrielle und gewerbliche Energiespeichersysteme spielen eine entscheidende Rolle als grundlegende Elemente, die die Betriebsstabilität von virtuellen Kraftwerken sicherstellen. Mit 16 Jahren umfassender Erfahrung und Engagement in der Branche hat Origotek Co., Ltd. schrittweise umfassende technische Unterstützung bei der Einführung von VPP-Anwendungen durch kontinuierliche Produktentwicklung bereitgestellt.
Das Team von Herrn Cheng hat sich 2009 auf das Design und die industrielle Forschung im Bereich kommerzieller Energiesysteme konzentriert. Unter seiner Leitung ist Origotek erfolgreich zur vierten Generation ihrer kommerziellen Energiesysteme übergegangen. Die Systeme der vierten Generation zeichnen sich nicht nur durch eine verlängerte Lebensdauer und eine höhere Energiedichte aus, sondern sind zudem in digitale Plattformen virtueller Kraftwerke integriert. Sie können eine Echtzeit-Synchronisation mit VPP-Systemen durchführen, um automatisch auf Dispositionsanweisungen zu reagieren und einen sofortigen Energieaustausch mit VPP-Plattformen zu ermöglichen, um Lastspitzenabflachung, Bereitstellung von Backup-Leistung sowie die Kompensation von Dreiphasen-Asymmetrien zu unterstützen.
Darüber hinaus wird die Integrationsleistung von virtuellen Kraftwerken durch die maßgeschneiderten Gesamtenergiekonzepte von The Origotek für die Industrie- und Gewerbekunden weiter verbessert. Das Unternehmen entwickelt individuelle Strategien zur Integration von Energiespeichern und virtuellen Kraftwerken für Unternehmen, basierend auf deren Produktionsprofil, Energieverbrauchsmustern und den regionalen Strommarktdynamiken, wodurch Unternehmen ihre energiebezogenen Betriebsrisiken und -ressourcen effizient steuern können.
4. Der praktische Weg der virtuellen Kraftwerke zur Förderung der „Energiefreiheit“
Die Vision von „die Träume der Menschheit nach Energiefreiheit voranzutreiben“, wie sie von The Origotek formuliert wurde, steht in enger Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel der virtuellen Kraftwerke. Energiefreiheit bedeutet nicht nur, dass Unternehmen zuverlässigen und kostengünstigen Zugang zur Energie haben, sondern auch, dass die gesamte Wirtschaft Energie innerhalb eines geschlossenen Kreislaufsystems effizient nutzt.
VPPs fördern die Verwirklichung der Energiefreiheit auf zwei wesentliche Arten. Erstens ermöglichen VPPs durch die Aufhebung des Monopols traditioneller Stromversorgungsstrukturen eine stärkere aktive Beteiligung industrieller und gewerblicher Unternehmen an den Strommarkthandel, wodurch diese weniger von einer einzelnen Energiequelle abhängig sind. Zudem erhalten sie eine größere Flexibilität bei der Auswahl ihrer Energieversorgung entsprechend ihren Bedürfnissen. Zweitens beschleunigen VPPs den Einsatz erneuerbarer Energien. Die Verschwendung erneuerbarer Energien, die mit dem „Abschalten von Windkraftanlagen und Abschalten von Solarstrom“ verbunden ist, wird reduziert, indem VPPs dezentrale erneuerbare Energien mit Energiespeicherlösungen verbinden und so den Verbrauch ermöglichen sowie schrittweise den Übergang zu einer energiestruktur mit niedrigem Kohlenstoffausstoß und sauberen Alternativen vorantreiben.
Der Origotek, als Akteur in der Industrie- und Gewerbespeicherbranche, wird sich auf die Entwicklung neuer sicherer Industrie- und Gewerbespeichersysteme sowie wertstarker erneuerbarer Energiesysteme konzentrieren. Durch eine engere Integration mit Virtuellen Kraftwerken ermöglicht er Industrie- und Gewerbeunternehmen die Nutzung neuartiger Energiespeichersysteme mit „steuerbarer, effizienter und kohlenstoffarmer“ Energie und leistet so einen Beitrag zur globalen Energiewende.
5. Schlussfolgerung
Im Rahmen des Wandels des globalen Energiesystems verbinden Virtuelle Kraftwerke dezentrale Energiequellen mit Industrie, Gewerbe und dem Stromnetz. Sie optimieren den Energieeinsatz, wandeln das Versorgungssystem um und stabilisieren es und tragen dazu bei, die weltweiten Ziele für geringere Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Für die Sektoren Industrie und Gewerbe stellt der sich rasant entwickelnde VPP-Markt in den kommenden Jahrzehnten eine zentrale Chance dar, ihre strategische Position zu stärken.
Die Entwicklung von VPPs wird durch die fortschreitende Reife der Energiemärkte und den unaufhaltsamen Aufstieg digitaler Technologien vorangetrieben. Durch eine intensive Einbindung in kommerzielle und industrielle Energiespeicherlösungen wird The Origotek die VPP-Branche mit wertvollen und bedeutenden technologischen Ressourcen voranbringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Der neue Motor der modernen Energiewende
- 2. Kernwert und Funktionsmechanismus Virtueller Kraftwerke
- 2.1 Überwindung der „Zersplitterung“, um „Aggregation“ zu erreichen
- 2.2 Schaffung eines Win-Win-Musters für Unternehmen und Netze
- 3. Integration von virtuellen Kraftwerken und Speicherlösungen
- 4. Der praktische Weg der virtuellen Kraftwerke zur Förderung der „Energiefreiheit“
- 5. Schlussfolgerung